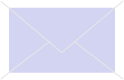Die Verfilmung bekannter Kinderbücher liegt groß im Trend. Fehlt es an neuen Ideen und Figuren? Wir haben die Produzentin Isabel Hund gefragt, warum man beim Kinderfilm so gern auf Bekanntes setzt und was ein guter Kinderfilm braucht.
Kinderbuchverfilmungen sind sehr beliebt – und immer mehr davon kommen in die deutschen Kinos. Letztes Jahr feierte ein neuer „Heidi“-Film Erfolge, seit Anfang Dezember können sich Eltern zusammen mit ihren Schützlingen über die Neuverfilmung der Geschichte des kleinen Roboters Robbi und seines Fliewatüüts freuen und gerade wird der Klassiker von Otfried Preußler „Die kleine Hexe“ fertig abgedreht. Vor allem deutsche Produktionen setzten auf Stoffe, die einem großen Publikum bereits bekannt sind und einen möglichst hohen Beliebtheitsgrad haben. Warum das so ist und was ein guter Kinderfilm braucht, dazu haben wir Isabel Hund von Studiocanal befragt, die schon viele erfolgreiche Produktionen betreut hat.
Frau Hund, was macht einen guten Kinderfilm aus?
Ein guter Kinderfilm sollte so gemacht sein, dass sich die Kinder der Altersgruppe, für die er gedacht ist, damit identifizieren können und er sollte die Themen so erzählen oder aufbereiten, dass sie kindgerecht sind. Aber weil Kinder bis zu einem Alter von 11 oder 12 Jahren meistens von ihren Eltern oder anderen Erwachsenen ins Kino begleitet werden, sollten natürlich auch diese möglichst Spaß am Film haben. Das ist unser Ziel. Denn natürlich stehen die Kinder mal vor Plakaten oder sehen einen Trailer und sagen: „Das wollen wir sehen!“, aber das letzte Wort, welcher Film geguckt wird, haben eben doch die Eltern.
Und die bezahlen schließlich auch die Tickets an der Kinokasse …
Genau, und das ist auch der Unterschied zwischen echtem Family-Entertainment und einem reinen Kinderfilm. Natürlich ist unser Hauptzielpublikum die Kinder, aber es ist auch wichtig, dass die Eltern nicht suggeriert bekommen: Ihr setzt euch jetzt 90 Minuten da mit rein und langweilt euch.
Im Moment werden auffallend viele Kinderbücher neu oder wieder verfilmt. Warum ist das so?
Deutschland war schon immer sehr stark geprägt davon. Wir haben sehr gute Autoren, die tolle Kinderbücher schreiben. Insofern ist die Tradition, diese Stoffe zu nehmen und fürs Kino zu verarbeiten, sinnvoll. Aber es hat noch andere Gründe, denn es reicht heutzutage nicht mehr, einfach einen schönen Film zu machen. Was wir brauchen ist ein Event, eine Marke, die schon eine gewisse Präsenz hat, auf die man im Film aufbauen kann. Da hilft die Bekanntheit und Beliebtheit eines Kinderbuches sehr. Die Leute kennen es, sie lieben es, sie wissen worauf sie sich einlassen.
Also ist eine Buchvorlage ein Garant für Erfolg?
Nein, so einfach funktioniert es nicht. Es kann auch nach hinten losgehen, nämlich dann, wenn man nicht den Film liefert, den die Leute erwarten. Es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, den Kern dessen zu bewahren, was das Kinderbuch liefert und genau das herauszuarbeiten, was die Leser daran lieben. Gleichzeitig wollen wir auch etwas Neues und etwas Größeres oder etwas Moderneres daraus machen, eine Geschichte die zeitgemäß ist und die die Leute letztlich dazu bringt, sich den Film anzusehen.

Das heißt im Umkehrschluss, es fehlt an neuen Stoffen?
Nein, gar nicht. Das Tolle im Bereich der Jugendbücher ist doch, dass immer neue Sachen herausrauskommen. Wir leiden nicht an einem Mangel an Ideen. Nehmen wir doch zum Beispiel die Sorgenfresser-Puppen. Das hat sich jemand vor einigen Jahren ausgedacht und jetzt sind sie überall. Es gibt Bücher und eine TV-Serie dazu. Das ist eine frische Idee gewesen. Ich bin davon überzeugt, es gibt immer Ideen die nachwachsen und jede Generation hat wieder etwas Neues.
Aber als Eltern hofft man, ins Kino zu gehen und von einer völlig neuen Geschichte überrascht zu werden. Wie damals bei „E.T.“ zum Beispiel.
Wir wünschen uns natürlich auch originäre Ideen. Aber man muss auch sagen, der Kinomarkt lebt im Family-Entertainmentbereich zu 95 Prozent von bestehenden Marken – und davon gibt es viele: Jim Knopf, Lego, Mullewapp … Bei originären Stoffen ist es leider so: Die Leute kommen nicht ins Kino! „E.T.“ würde ich trotzdem als Beispiel ausklammern. Wenn ich ein Marketingbudget von 120 Millionen Dollar habe, bekomme ich natürlich am Ende alle ins Kino. Amerikanische Studios, die Filme wie „Findet Nemo“ oder „Star Wars“ vertreten, spielen in einer ganz anderen Liga. Da reichen wir mit deutschen Produktionen nicht heran, was das Marketing betrifft. Die können unglaubliche Summen in die Werbung pumpen und damit eine Marke aufbauen. Wir sind da anders unterwegs und auf einer gewissen Bekanntheit angewiesen, die die Marke oder der Stoff vorher schon haben.
Dann sind Filme wie „Bibi und Tina“ also im Vergleich zu etwas Neuem leichter zu einem Erfolg an der Kinokasse zu machen?
Nein, das ist ein Trugschluss. Bei einer Vorlage, die über Generationen hinweg beliebt ist, kann man trotzdem keine Garantien geben. Wenn der Film inhaltlich falsch angelegt ist, wenn er falsch besetzt ist, wenn sich die Zuschauer nicht wiederfinden oder die Erwartungen, die man als Kinogänger hat, weil man das Kinderbuch liebte, enttäuscht werden, dann geht da niemand rein. Es ist nicht einfach so, dass man eine Marke nimmt und die Leute kommen automatisch ins Kino. Es steckt viel Arbeit dahinter herauszufinden: Was lieben die Leute an diesem Stoff und was erwarten sie, wenn sie ins Kino gehen. Denn es muss natürlich mehr passieren, als zu Hause vor dem Fernseher. Im Kino muss ein Erlebnis geboten werden.
Wie schaffen Sie es, den Kern der Marke zu treffen?
Wir haben Partner, entweder die Markeninhaber oder den Autor eines Buches, die ihre Fans und ihre Marke sehr genau kennen. Mit ihnen setzen wir uns zusammen und besprechen sehr genau die Zielgruppe und die Ausrichtung des Films. Wir drehen zum Beispiel gerade „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler. Seine Tochter Susanne verwaltet die Rechte und ist sehr in den Entstehungsprozess involviert. Schon bei der Drehbuchentwicklung haben wir mit ihr, dem Regisseur, dem Produzenten und dem Drehbuchautor immer wieder darüber geredet, wie weit wir uns bei den einzelnen Szenen von der literarischen Vorlage entfernen können – oder eben nicht. All diese Infos sehen wir uns vorher an und gehen immer wieder zurück und gleichen ab, ob wir das Herz der Geschichte beschützen, die richtige Emotionalität haben und sich unsere Ideen mit dem decken, was die Zuschauer erwarten.

„Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“ ist eine Geschichte aus den 70er-Jahren. Hoffen Sie in so einem Fall, dass die Eltern ihre Begeisterung für den Stoff weitertragen an ihre Kinder?
Wir wollen den Stoff natürlich so beleben, dass er beiden Zielgruppen gefällt. Wir möchten das bewahren, was die Fans aus Erinnerungen an ihre eigene Kindheit an der Geschichte lieben und das Ganze gleichzeitig für eine neue Generation aufbereiten. Die Schnittstelle zu finden, wo das zusammengeht, daran arbeiten wir bei solchen Filmen sehr hart.
Auch weil damit ein großes finanzielles Risiko verbunden ist…
Auf jeden Fall.
Wie hoch ist das Budget für Kinderfilmproduktionen?
Ein gut gemachter deutscher Family-Entertainmentfilm hat in der Regel ein Budget von vier bis sieben Millionen Euro. Das kommt immer darauf an, wie fantasylastig das Drehbuch ist oder wie aufwendig die Bauten sind. Bei dem Film „Heidi“, den wir letztes Jahr ins Kino gebracht haben, wollten wir möglichst nah an der literarischen Vorlage bleiben, die 1870 erschienen ist. Das heißt, wir haben eine komplette Bergwelt erschaffen, wie sie damals war. Das ist mit einem unglaublichen logistischen Aufwand verbunden, was immer auch bedeutet: Es wird teuer!

Und die Produktion von „Die kleine Hexe“ ist ebenso aufwendig?
Wir drehen dafür gerade im Fichtelgebirge und haben ein komplettes Hexenhaus mit allem drum und dran in einen Wald gebaut. Das macht zwar unglaublich viel Spaß, aber es bedeutet auch ein großes logistisches Engagement, was die Produktion natürlich verteuert. Bei „Robbi, Tobbi …“ standen wir vor der Herausforderung, einen Roboter zu bauen und ihm eine Mimik zu geben. Diese drückt sich am Ende nur über die Augenbrauen aus, die er heben oder senken kann. Da sitzt man also schon mal fünf Wochen lang und denkt über Länge, Dicke und Form von Augenbrauen nach und probiert immer wieder aus. Wie gesagt: Die Detailversessenheit macht Spaß, ist wichtig für den Film, macht das Ganze aber auch teuer.
Aufmacherbild: studiocanal