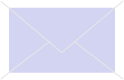Frau Winter, mit Wutausbrüchen ihrer Kinder sind alle Eltern in den ersten Lebensjahren konfrontiert. Was hat es mit dieser berüchtigten Trotzphase auf sich?
Romy Winter: Zuerst einmal plädiere ich für einen Perspektivwechsel. Wenn wir das Phänomen nicht als Trotzphase verstehen, sondern als Autonomiephase, wie die Entwicklungspsychologie es tut, dann ist es nicht mehr ganz so bedrohlich oder bösartig. Trotz ist ja eine Art willentlicher Verweigerung, und die trifft oft bei Kindern in dem Alter gar nicht zu. Vielmehr durchlaufen sie gerade eine ganz wichtige Phase in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit: Sie erleben plötzlich ein gesteigertes Ich-Bewusstsein und damit einher geht der Wunsch nach Eigenständigkeit, nach Loslösung. Dieses Bedürfnis steht im Gegensatz zu ihrem Wunsch nach Nähe zu uns, und diese Spannung überfordert Kinder mitunter. Sie wissen dann nicht, was sie jetzt eigentlich wollen.
Und die Überforderung entlädt sich in Wut und Frust?
Genau. Hinzu kommt, dass Kinder in dieser Phase verstärkt ihren eigenen Willen entwickeln. Wenn wir als Eltern unseren Kindern dann Grenzen setzen, behindern wir ihr Streben nach Selbstwirksamkeit. Was zu Frust und Wut führt. Die Wut stellt sich auch oft ein, weil der Wunsch nach Selbstwirksamkeit in diesem Alter größer als die Möglichkeit dazu ist. Die Kinder wollen nun viele Dinge alleine machen, aber ihre motorischen und kognitiven Fähigkeiten reichen dafür noch nicht aus oder wir Eltern geben ihnen nicht die nötige Zeit oder Gelegenheit – was oft auch gar nicht anders geht. In dieser Phase machen Kinder große Fortschritte bei der Emotionsregulation. Denn sie sind gezwungen, Strategien zu entwickeln, wie sie mit diesem Frust, der Wut, der Traurigkeit umgehen. All das ist enorm wichtig für die Entwicklung und Resilienz. Zudem beginnen Kinder in der Autonomiephase auch, ihren Platz in sozialen Gefügen einzunehmen, also ihren Willen mit anderen auszuhandeln, und das sind natürlich erst mal wir Eltern, Geschwister oder Erzieher. Und das ist von großer Bedeutung für ihre Sozialisation und soziale Kompetenz.
Aber auch sehr anstrengend. Können Eltern ihr Kind in dieser Phase in irgendeiner Form unterstützen oder müssen sie sie einfach durchleiden?
Viele Eltern glauben, dass sie den Frust, den sie etwa durch ein Verbot selbst ausgelöst haben, nicht gleichzeitig auch liebevoll begleiten können. Aber die Emotionsregulation ist in dieser Phase für Kinder ganz wichtig, und das können sie nicht alleine. Hier sollten Eltern helfen, beruhigen oder dem Kind alternative Möglichkeiten anbieten, um den Frust abzulassen, etwa durch körperliche Aktivität.
Eine Klärung, also Besprechung der Situation, kann erst funktionieren, wenn das Kind sich beruhigt hat. Eltern wollen, glaube ich, in der Situation manchmal zu viel. Dabei ist einfach Geduld gefragt – aufräumen kann man erst, wenn der Sturm vorüber ist. Ganz wichtig ist, dass sich Kinder in dieser schwierigen Phase unserer Liebe und Zuneigung sicher sein können. Eltern sollten auf Trotzreaktionen also nicht mit Wut, Drohungen oder Strafen reagieren. Dinge alleine machen wollen dauert erst mal länger und entsprechend Zeit und Geduld sollten Eltern in dieser Phase einplanen. Auch Wortschatzarbeit ist hilfreich. Also dem Kind seine Gefühle in der Situation begreifbar machen, sie benennen, damit es sie später selber leichter regulieren kann. Und unglaublich wichtig ist es, Ausgleichsmöglichkeiten und Freiräume zu schaffen, wo Eltern mal durchatmen und auftanken und wo Kinder sich ausprobieren und ihre Autonomie leben können, ohne von uns beschränkt zu werden.
Ein anderes anstrengendes Thema ist der ständige Streit unter Geschwistern. Haben diese Auseinandersetzungen ebenfalls einen entwicklungspsychologischen Sinn?
Durchaus. Geschwisterbeziehungen sind gewissermaßen Übungsbeziehungen, Kinder lernen hier wichtige soziale Kompetenzen, etwa ihre Bedürfnisse zu äußern, Kooperationen einzugehen, Konflikte zu lösen und ihre Emotionen zu regulieren. Streits sind aber auch Ausdruck der Rivalität, die immer unter Geschwistern herrscht, auch wenn Eltern sich große Mühe geben, das zu verhindern. Geschwister müssen ja alles teilen: die Spielsachen, den Inhalt des Kühlschranks, die Aufmerksamkeit der Eltern. Je mehr Kinder sich selbst überlassen sind oder sich nicht genug gesehen fühlen von den Eltern, umso mehr wird auch diese Rivalität ansteigen.

Kann man so einen Streit verhindern? Soll man das überhaupt oder ist es besser, wenn die Kinder das untereinander regeln?
Streit ganz zu verhindern ist weder möglich noch nötig. Aber Eltern können die Konkurrenz mindern, indem sie sich für jedes Kind exklusiv Zeit nehmen. Und den Zusammenhalt der Kinder durch kooperative Spiele fördern, wo Geschwister sich nicht als Rivalen begreifen, sondern als Team. Das Teamgefühl wird ebenfalls gestärkt, wenn wir ihnen zutrauen, Konflikte auch mal allein zu lösen. Meine kleine Faustregel hier: Eltern dürfen sich immer ein bisschen länger raushalten, als sie glauben, dass es gut wäre, außer sie beobachten Gewalt oder große seelische Not.
Wie sieht eine gute Streitschlichtung aus?
Dabei dürfen wir unterstützen, müssen aber aufpassen, dass wir nicht als Richter auftreten oder als Anwalt eines Kindes. Die Einladung, das jüngere Kind zu verteidigen, weil das ältere ja einen Entwicklungsvorsprung hat, ist definitiv da. Aber oft erwarten wir zu viel von den „Großen“. Auch sie sind Kinder, die aus einer gewissen Not heraus agieren. Wir sollten uns deshalb tatsächlich als Vermittler begreifen und immer beide Seiten anhören. Meistens haben wir nicht alles gesehen und können uns nur schlechte Urteile erlauben.
Für Dauerzoff in Familien sorgt auch das Thema Bildschirmzeit… Sollen Eltern hier die Autonomie ihrer Kinder respektieren oder ihnen Grenzen setzen?
Hier ist meiner Ansicht nach elterliche Führung gefragt, auch wenn das den Unmut unserer Kinder erregt. Wir wissen, dass digitale Medien, also der Gebrauch von Smartphones, Tablets und ähnlichen Spielkonsolen, dieselben Areale im Gehirn aktiviert wie zum Beispiel Glücksspiel. Niemand würde sein Kind sehenden Auges in die Glücksspielsucht rennen lassen. Auch beim digitalen Medienkonsum haben wir die Verantwortung, den Konsum auf ein verträgliches Maß zu beschränken. Natürlich sollten wir Kindern den Zugang nicht gänzlich verwehren, denn ein Teil ihrer (sozialen) Entwicklung findet heute in der digitalen Welt statt. Aber wir sollten sie auch nicht sich selbst überlassen. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit geregelten Nutzungszeiten bzw. begrenztem Gerätezugang gemacht, weil Kinder dann nicht ständig in Versuchung geführt werden. Das Verlangen nach einem Dopaminkick ist ja immer da und klare Auszeiten verhindern das Entstehen einer Abhängigkeit.

Wie kann man einen Kompromiss finden, mit dem alle Seiten glücklich sind?
Je älter die Kinder sind, umso wichtiger wird es natürlich, dass wir sie einbeziehen auch bei der Frage: Wann und wie lange möchtest du das nutzen? Aber ich glaube, wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass am Ende alle super glücklich damit sind, denn es gehört zum Elternsein, manchmal unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Kindern also nicht nur zu geben, was sie wollen, sondern was sie für eine gesunde Entwicklung brauchen – Bewegung, Natur, Zusammensein mit anderen Menschen. Für Kinder ist es so viel einfacher, sich in der virtuellen Welt zurechtzufinden, dass ich manchmal wirklich Sorge habe, sie sind gar nicht mehr dazu bereit, sich mit echten Konflikten auseinanderzusetzen, was aber für ihre Frustrationstoleranz und Persönlichkeitsentwicklung unglaublich wichtig wäre. Gerade soziale Kompetenzen und Fähigkeiten drohen zu verkümmern, wenn wir uns nur in der digitalen Welt bewegen.
Wie viel Digitalzeit empfehlen Sie für welches Alter?
Kinder sind sehr individuell und sehr verschieden, einige Kinder können sich schon früh regulieren oder sind einfach nicht so suchtanfällig, andere benötigen auch im Teenageralter noch Unterstützung. Das Umfeld spielt ebenfalls eine Rolle: Handys oder Konsolen sind in unterschiedlichen Kreisen unterschiedlich präsent. Insofern finde ich es schwierig, Regeln für verschiedene Alter festzulegen. Für mich ist es jedoch ein Unterschied, ob das Gerät nur punktuell genutzt wird – etwa um einen Film zu gucken oder mit Freunden zu gamen – oder immer verfügbar ist wie ein Smartphone. Wir leisten unseren Kindern meiner Meinung nach einen guten Dienst, wenn wir ihnen das Smartphone nicht vor Abschluss der Grundschule in die Hand drücken. Und auch danach die Nutzungszeiten und Inhalte einschränken. Vor allem aber selbst Vorbild für einen bewussten Umgang mit digitalen Geräten sind, was – Hand aufs Herz – auch uns Erwachsenen schwerfällt.
Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben, was Familien tun können, um ihre Resilienz zu steigern und besser mit den vielen großen und kleinen Krisen des Zusammenlebens umzugehen. Worum geht es dabei im Kern?
Ich habe Erkenntnisse der Resilienzforschung mit Methoden und Ansätzen der systemischen Familientherapie kombiniert und sieben „Familienz“-Faktoren identifiziert, die Familien stark für das Leben machen und die sie selbst einüben können. Das Wichtigste sind verlässliche Bindungen und Beziehungen. Wobei in einem Familiensystem alle Mitglieder unterschiedliche Beziehungen zueinander haben, die alle Unterschiedliches benötigen und ein Recht auf Exklusivität besitzen. Resiliente Eltern respektieren das. Sie nehmen die Bedürfnisse ihrer Kinder wahr und erfüllen sie nach Möglichkeit, verleugnen dabei jedoch ihre eigenen Bedürfnisse nicht. Sie bleiben integer und authentisch, kommunizieren achtsam, lösungsorientiert und auf Augenhöhe mit ihren Kindern, übernehmen aber klar die Führungsrolle, damit die Kinder sich ungestört entwickeln und ausprobieren können. Resiliente Familien finden heraus, was wem wann am besten hilft und vertrauen auf die Kraft von Ritualen, die Halt und Orientierung geben. Sie gehen das Leben zuversichtlich, mit Optimismus und Humor an und schaffen es, Konflikte konstruktiv zu lösen und daran zu wachsen.
Max Frisch sagte mal: Krise ist eigentlich ein produktiver Zustand, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. – Ich finde, das dürfen wir uns auch als Familien immer wieder bewusst machen.

Jede Familie kennt Krisen, mit ihrer Bewältigung sind viele jedoch überfordert. In ihrem „Familien-Kompass für stürmische Zeiten“ erklärt Romy Winter, was Einzelne und Familien widerstandsfähig und stark für das Leben macht – und wie sich diese Eigenschaften trainieren lassen. Klug, warmherzig, ehrlich. Unbedingt lesenswert!
Romy Winter: Krisenfest,
Kösel Verlag 2021, 20 Euro
Bilder: Gettyimages, privat
IMMER AUF
DEM NEUSTEN
STAND SEIN!